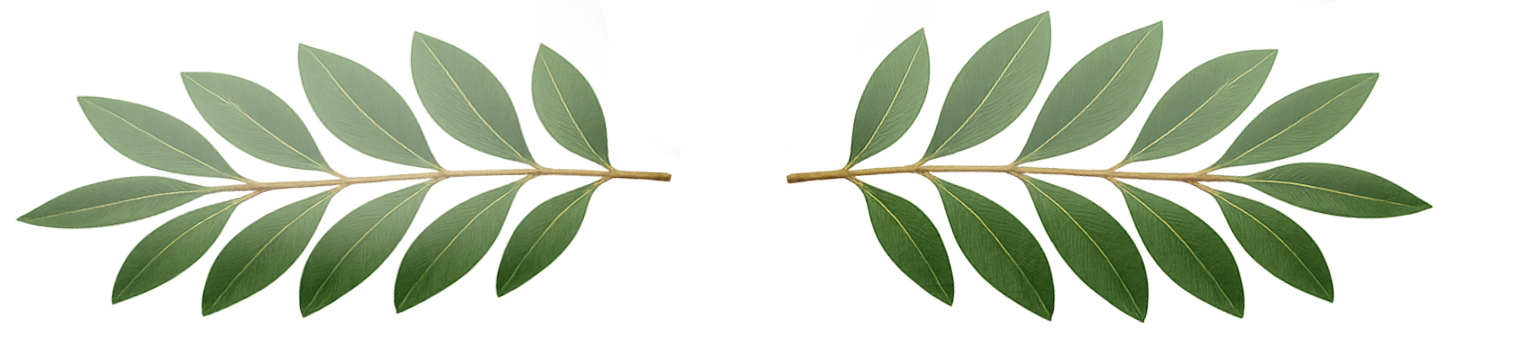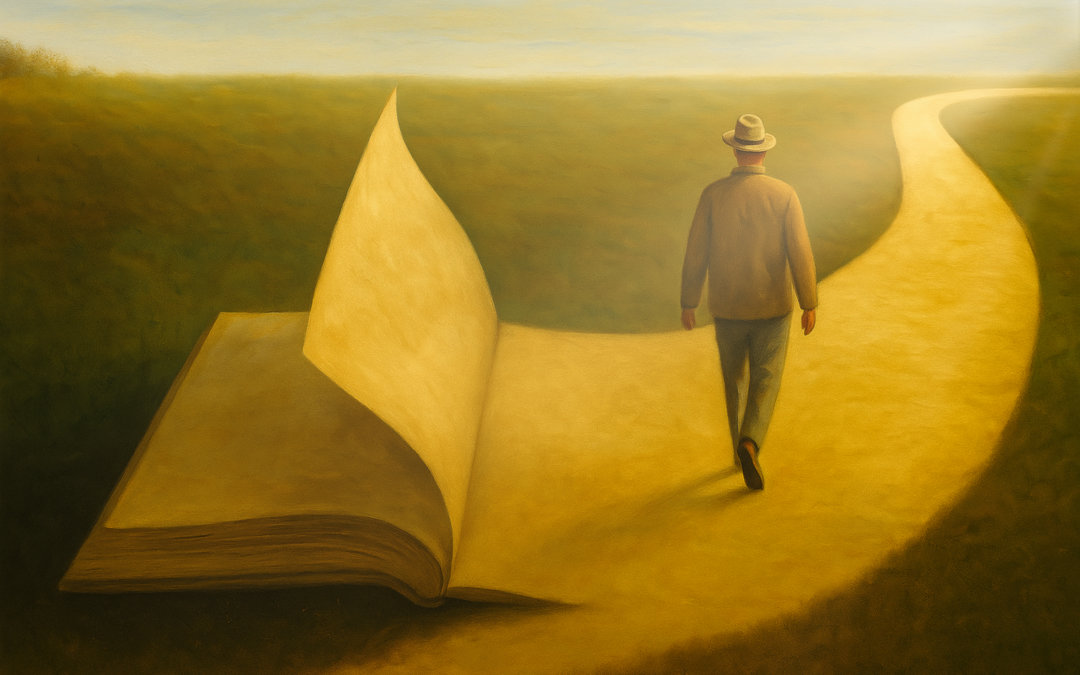In unseren modernen Gesellschaften wird Demenz meist als ein Verlust der geistigen Fähigkeiten, des Gedächtnisses und der Vernunft betrachtet. Für die Angehörigen ist sie oft ein stiller Schmerz. Sie sehen, wie der geliebte Mensch sich langsam entfernt – wie hinter einem Schleier. Der Elternteil, der Partner, die Stütze – sie werden zu jemand anderem: zerbrechlich, unberechenbar, manchmal kaum wiederzuerkennen.
Das tut weh. Denn man möchte das alte Gesicht festhalten – das von früher. Und je weiter die Demenz fortschreitet, desto schwerer fällt es, diese Person in ihren Gesten, Worten oder Abwesenheiten wiederzuerkennen. So schwanken die Angehörigen oft zwischen Zärtlichkeit und Erschöpfung, zwischen Nähe und Rückzug. Weil es schwer ist. Weil man nicht wirklich versteht, was geschieht. Weil unsere Kultur nie gelernt hat, Demenz anders zu sehen als einen Verfall.
Also schaffen wir Distanz. Wir sprechen von „Krankheit“, wir geben die Verantwortung an Institutionen ab, wir vermeiden das Hinschauen. Denn es berührt in uns etwas Tiefes – unsere eigene Verletzlichkeit, Abhängigkeit, den Verlust der Kontrolle. All das, was unsere leistungsorientierte Gesellschaft am liebsten verdrängt.
Und was, wenn Demenz keine Fehlfunktion wäre,
sondern eine Einladung, hinzusehen
auf das, was in uns selbst noch Heilung sucht?
Im Lauf des Lebens begegnen wir Momenten voller Schönheit, Verbindung und Entdeckung – aber auch dunkleren, schmerzhaften Passagen. Wenn Schmerz gesehen und angenommen werden kann, wird er zur Quelle der Wandlung, ein Tor zu mehr Bewusstsein. Fehlen jedoch die inneren oder äußeren Ressourcen, um ihn zu transformieren, lernt der Geist, das Untragbare zu verbergen. Verletzungen, Ängste, Schocks – all das, was zu schwer war, zieht sich in die Tiefe zurück, überdeckt von Geschichten, die uns helfen, weiterzumachen, zu funktionieren, zu überleben.
Was nicht vollständig durchfühlt wurde, verschwindet nicht. Es bleibt, still und verborgen in den tieferen Schichten des Seins. Diese unverdauten Erinnerungen wirken weiter im Hintergrund: Sie beeinflussen Gefühle, Verhaltensmuster und manchmal auch den Körper. Wenn mit dem Alter die mentalen Barrieren schwächer werden und die Wachsamkeit nachlässt, kann all das Verborgene wieder auftauchen. Als ob das Leben eine letzte Gelegenheit böte, das Unausgesprochene ins Licht zu holen – nicht durch Worte oder Verstand, sondern durch rohe Emotion, durch die Erinnerung der Seele.
Vielleicht flüstert uns das Leben im Spiegel der Demenz zu:
„Kümmere dich um deine eigenen Wunden,
bevor sie einen anderen Weg finden, sich zu zeigen.“
Dieses Phänomen zeigt sich in verschiedenen Stadien der Demenz. Die Betroffenen scheinen in der Zeit zu reisen, alte Szenen noch einmal zu erleben und darüber zu sprechen, als geschähe es hier und jetzt. Das geschwächte Gehirn verliert an Kontrolle, und was einst verborgen, unterdrückt oder beherrscht war – Ängste, Schmerzen, Überlebensreflexe – steigt wieder an die Oberfläche. Gefühle brechen hervor: Tränen, Wut, Misstrauen, Unruhe … Für uns mag das chaotisch und sinnlos wirken, doch all diese Emotionen tragen Bedeutung. Es sind Bruchstücke alter Geschichten, energetische Spuren, die sich ausdrücken – vielleicht, um endlich gesehen und befriedet zu werden.
Über die medizinische Ebene hinaus lässt sich darin eine tiefere Bewegung erkennen – als würde die Seele, auf einer höheren Bewusstseinsebene, die Schwelle des Verstandes nutzen, um ihre ältesten Erinnerungen an die Oberfläche zu bringen.
Was, wenn Demenz keine Schwäche, sondern eine Öffnung wäre?
Ein Übergang, in dem die Seele bereits beginnt, zu ordnen, loszulassen und Frieden zu schließen – bevor sie ihre grosse Reise antritt.
Demenz auf diese Weise zu betrachten heißt, sie als Ausdruck der Seele unseres geliebten Menschen zu sehen. Es bedeutet, jenseits der Worte zu lauschen, die Energie wahrzunehmen, die sich durch ihn ausdrücken möchte. Vielleicht gibt es darin einen tieferen Sinn, eine verborgene Weisheit, die sich hinter der Verwirrung offenbart.
Dann frage ich mich:
Was wollen uns diese Erfahrungen lehren? Und wenn sie eine Botschaft an uns sind – die Angehörigen, die Nachkommen? Ein Aufruf, hinzusehen, zu verstehen, zu lernen aus dem, was geschieht. Vielleicht können wir diese Botschaft hören: „Kümmert euch um eure Wunden. Versteckt sie nicht in der Hoffnung, dass sie von selbst verschwinden.“
Was unsere Ältesten uns zeigen, sind die Folgen eines Lebens, in dem Schmerz und Verletzung keinen Raum fanden, gesehen und gehalten zu werden. Sie rufen uns dazu auf, diese Arbeit jetzt zu tun – für uns selbst und für die kommenden Generationen.
Demenz auf diese Weise zu sehen, bedeutet, das Urteil in Mitgefühl zu verwandeln. Hinter den verwirrten Worten erkennen wir die Bewegung einer Seele, die nach Frieden sucht, nach innerem Gleichgewicht. In dieser Reise, die für die Beobachtenden oft verstörend ist, offenbart sich eine tiefe Würde. Es bedeutet auch, anzuerkennen, dass diese Geschichten Teil eines grösseren Gewebes sind – der Geschichte unserer Eltern und Ahnen – und dass sie unseren Respekt, unsere Sanftheit und unser Mitgefühl verdienen.
Und vielleicht tragen wir, indem wir sie mit Zärtlichkeit und Offenheit begleiten, auch selbst zur Heilung unserer eigenen Geschichte bei.